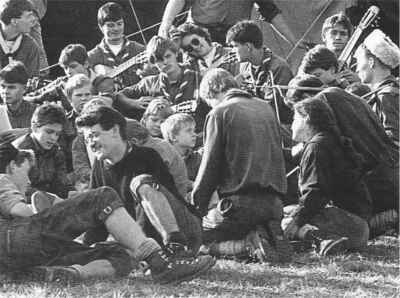
Was
ist bündisch?
LUDWIG LIEBS
Was kennzeichnet eine gute
Jungengruppe, die sich bündisch nennt, die sich der bündischen Jugend
zugehörig fühlt? Ist es die Freundschaft, die die einzelnen Jungen in
ihr und mit dem Gruppenführer verbindet? Genügt Freundschaft, genügt
die Summe solcher Freundschaften, damit eine bündische Gruppe lebt?
Daß Freundschaft zugleich Liebe meint,
Liebe im tiefstverstandenen christlichen Sinne, muß gesagt, kann aber
auch mißverstanden werden. Liebe also nicht als Sentiment, als kleines Glückserlebnis,
als Rausch ohne Tiefe, sondern Liebe als das ganz Große, das den
Liebenden mit seinen ihm vorgegebenen Nächsten verbindet.
Machen Freundschaft, Liebe in diesem
Sinne, allein schon das Wesen des Bündischen aus?
Ein kurzer geschichtlicher Rückblick:
Das Sich-Zusammenfinden junger Menschen, das um die Jahrhundertwende in
Deutschland begann, nannte sich zunächst J u g e n d b e w e g u n
g . Das Bewegende und Bewegte wurde betont, die Fort-Bewegung von
hergekommenen Lebensformen, Lebensinhalten zum Eigenen hin. Das Suchen
stand im Vordergrund, auf vielen Wegen, in vielen Experimenten, in viele
Gefährdungen hinein. Bünde wuchsen und splitterten sich wieder auf. Eine
fast unübersehbare Vielfalt entstand. Etwa zwei Jahrzehnte später begann
für diesen lebendigsten Teil Deutscher Jugend ein neuer geschichtlicher
Abschnitt. Gruppe, Gau und Bund wurden immer mehr zur selbstverständlichen,
zwar oft diskutierten, aber nie in Frage gestellten großen Aufgabe, zur
Notwendigkeit des eigenen, gemeinsamen Lebens, um die man miteinander
rang. Volk und Nation wurden als Aufgaben begriffen, nicht als höchste
Werte.
Man war bereit, für den Bund vieles,
mitunter alles einzusetzen. Man war bereit, das ganze Leben von der
Gruppenzeit über das Studium, über die Berufswahl hinweg auf den Bund
hin anzulegen. Dabei wurde der Bund, so wie ich ihn kennengelernt habe,
nicht idealisiert. Norbert Körber nannte ihn einmal eine ernst, mit
zusammengebissenen Zähnen zu bewältigende Aufgabe. wenn wir an den Bund
in diesem Sinne dachten, so meinten wir auch gar nicht mal immer so sehr
den einen Bund, dem wir organisatorisch und in vielen menschlichen
Bindungen zugehörten. Da Bund die große Aufgabe war, deren Erfüllung
eigentlich erst in der Zukunft lag, waren die unserem Wesen verwandten Bünde
in Gedanken, mindestens in der Intuition einbezogen.
Kamen
die Freundschaften, kam die Liebe dabei zu kurz? Mitunter gab es
Diskussionen, ob der einzelne Mensch um der Gruppe, um des Bundes willen
da sei oder ob Gruppe und Bund um des Einzelnen willen bestanden. Wir
fanden, die Frage sei falsch gestellt. Eine Gruppe, ein Bund, der nicht
denen, die dazugehören, die tiefste Erfüllung des Lebens ermöglicht,
hat seinen Sinn verfehlt. Aber zur Sinnerfüllung des Einzelnen gehörte
eben für uns ganz und gar das In-der-Gruppe-Sein, das Im-Bunde-Sein. Um
unserer selbst willen zunächst, das war der Ausgangspunkt. Aber auf
diesem Willen, auf dieser Sehnsucht, auf dieser Getriebenheit, auf dieser
Entelechie bauten sich Gruppe und Bund auf.
Als
sich mehrere der lebendigsten Pfadfinderbünde mit den, so darf man es
wohl schon nennen, jungenschaftlich gewordenen Wandervogelbünden und
ihren Jungmannschaften zusammenschlossen zur großen D e u t s c h e n
F r e i s c h a r , da vollzogen weitschauende Führer den
vorgegebenen Willen ihrer Gruppen und Gaue. Sie trugen dazu bei, eine bündische
Sehnsucht Wirklichkeit werden zu lassen, die in der jahrelangen
Entwicklung seit dem Ende des 1. Weltkrieges immer stärker geworden war.
Wenn ich im folgenden fast ausschließlich von der Deutschen Freischar
spreche, so deswegen, weil sich mir
in ihr d a s B ü n d i s c h e am
sichtbarsten, am lebendigsten verkörperte.
Als im Jahre 1931 bei Crossen an der Oder, dort wo der Bober vor seiner Einmündung in den größeren Fluß eine große Schleife bildet, dreitausend Jungen, junge Männer und eine Reihe "gestandener Mannsbilder", wie man in Bayern sagen würde, zum Bundestag zusammenkamen, als auf diesem Bundestag auf Schritt und Tritt eine tiefe brüderliche Verbundenheit über die Grenzen der Gruppen und Gaue hinweg unmittelbar zu spüren war, lebendig war, im Leben des Bundestages wirkte, ist dort Bund im Sinne Bündischer Jugend sichtbar geworden. Zu dieser Zeit gehörten etwa 8 - 10.000 Jungen und junge Männer zur Deutschen Freischar. Bund war eine Wirklichkeit über das ganze Gebiet des damaligen Deutschen Reiches hin, auf die man sich verlassen konnte. Kam man von Sachsen nach Bayern, von Schlesien nach dem Rheinland, so war man bei jedem, der zum Bunde gehörte, Gast, auch wenn man ihn vorher persönlich nicht gekannt hatte.
Niemals
allerdings war Bund vollendete Harmonie. Es gab Mißverstehen, Krach,
Gegensätze und Auseinandersetzungen bis zu tiefster persönlicher
Feindschaft hin. Aber der Bund wurde davon nicht betroffen. Ich will nicht
sagen: man war in ihm geborgen. Geborgenheit gab es wenig in jener Zeit.
Der Bund war das Fordernde für uns, das Anspornende, das uns Aufgegebene,
obgleich und weil es kein Programm, keine Satzung, keine formulierte
alleingültige Marschrichtung des Bundes gab.
Wir
w a r e n b ü n
d i s c h aus
einem tiefen Ahnen und Wollen heraus, weniger aus einem bewußten Entschluß.
Das Bewußtmachen wurde später versucht, war auch notwendig, war aber
damals nicht Voraussetzung. Wir fühlten,
wie sinnlos unser Leben sein würde, wenn es nicht von einer starken
Bindung zum geliebten anderen Menschen erfüllt war, wenn es ohne
Freundschaft war. Aber mir ist gerade in jener Zeit auch immer wieder bewußt
geworden, wie leicht jede Freundschaft sich abnutzen kann, wenn sie abgeschlossen
bleibt von einem Umfassenderen, wenn nur der Freund den Freund als sein
Gegenüber hat, in ständiger Wiederholung. Heimabend, Fahrt, Singen,
Musizieren, Werken, Gestalten, Spielen in aller vielfältigen Art, alles
das ist in der Gruppe großartiger, lebendiger, fruchtbarer als in der
Zweisamkeit, weil immer wieder vom Beispiel der Gleichaltrigen und der
Erfahreneren, der Könnenden angeregt. Das alles machte unsere
Freundschaften schöner, größer, sinnvoller.
Zum
bündischen Wesen gehörte, und das ergab sich zwanglos aus der
Gemeinsamkeit im Gau, seltener in der für sich lebenden Gruppe, daß
nicht nur Freundschaften zwischen Gleichaltrigen entstanden, sondern
starke Bindungen über alle Spannen des Lebensalters hinweg. Der pädagogische
Eros fand Möglichkeiten des Wirkens, der Verwirklichung, die im System
unserer Schulen und in der isolierten Familienerziehung nur ganz selten
gegeben waren. Die fruchtbare geistige und menschliche Verbundenheit
zwischen Sokrates und seinen Schülern, von der wir auf den Gymnasien
begeisterte Schilderungen unserer Altphilologen gehört hatten, blieb uns
Theorie, bis wir sie im Bunde selbst erlebten.
Nun,
das ist Geschichte. Geschichte der Bündischen Jugend. Fast alles, was in
den 20er Jahren entstand, wurde 1933 und 1934 mitten im Wachsen brutal
zerschlagen. Anfang der 50er Jahre haben einige
Vielleicht
können ein paar Arbeitsthesen dazu beitragen, zur Klärung dessen zu
helfen, was in dieser Zeit möglich und, davon bin ich überzeugt,
notwendig ist:
1.
Alles kommt auf den M
e n s c h e n an, auf
den einzelnen, einmaligen Menschen, auf die Erfüllung, die Erfülltheit
(Gegenteil von Leere) seines Lebens. Die Erfülltheit findet er nicht in
der Isolierung, nicht im Alleinbleiben.
2.
Nur wer zur Freundschaft, wer zur Liebe fähig ist, ist auch fähig,
zu einer Gruppe, zum Bund zu gehören.
3.
Gruppe und Bund tragen ihren Sinn in sich. Immer aber sind sie und
müssen sein der Lebensraum, in dem sich die zu ihnen gehörenden Menschen
und die Freundschaften unter ihnen voll entfalten können.
- Zum bündischen Wesen gehört die Verbundenheit über die Generationen hinweg. Der Wert eines Menschen und seine Bindung an ihn wird nicht von seinem Alter bestimmt, weder im positiven noch im negativen Sinne, sondern durch die Qualität seines Menschseins.
5.
Das
sinnvolle Leben des Einzelnen, Freundschaft, Liebe, lebendige Gruppe und
wirklicher Bund sind nicht möglich ohne die (wenigstens im Unbewußten
wirkende) Religio, ohne die Rückbindung (re-ligio) an ein
Transzendentales, ohne metaphysische Entelechie.
6.
Die
größte Gefahr für jede Gruppe und jeden Bund und auch für jede
Freundschaft ist der Versuch, die Versuchung, einen anderen Menschen
besitzen zu wollen, über ihn verfügen zu wollen, ihn beherrschen zu
wollen, ihn zu vereinnahmen. Besitzwille ist auch das Gegenteil von Führung
im bündischen Sinn.
7.
Bündisch sein heißt auch, immer und vor allem ganz und gar Mensch
sein, mit Geist und Körper, mit Leib und Seele. Es kann und darf nie eine
Moral des Bundes geben, sondern immer nur das Gesetz der Liebe. Wo Bund
ist, für den bündischen Menschen also bedarf es nur dieses Gesetzes, des
Liebesgebotes, so wie es einst der Gruppenführer Jesus von Nazareth
ausgesprochen hat. Dies ist das Fundament des Bündischen, des
B u n d e s.